Was verbirgt sich hinter dem allgegenwärtigen Schlagwort »Cancel Culture«? Erleben wir in der Literatur eine neue Form der Zensur oder eine längst fällige Sensibilisierung für Diskriminierungen? Gibt es sie wirklich, diese Cancel Culture? Und wenn ja, wer cancelt hier eigentlich wen? In diesem Buch wird gestritten – differenziert, vielstimmig und erhellend.
(Klappentext von Canceln, Carl Hanser Verlag 2023)
»Cancel Culture« ist ein politisches Schlagwort, das im Literaturbetrieb aufgegriffen wurde, um über die Frage zu diskutieren, wem eigentlich erlaubt ist, was zu sagen. Der Begriff bedeutet »Streich- oder Abbruchkultur«, bekannter ist die Rede von der sogenannten »kulturellen Aneignung«. Cancel Culture bedeutet nicht nur die Anklage bestimmter diskriminierender, übergriffiger Sprech- und Schreibweisen, sonderrn auch die Ächtung der Sprecherinnen und Sprecher, die mit einer Entschuldigung kaum noch heilen können, was an Schmerz bei den Angesprochenen empfunden wird. Vielmehr sollen die Täter oder »Täter« – da gehen die Probleme schon los – generell in Verruf geraten.
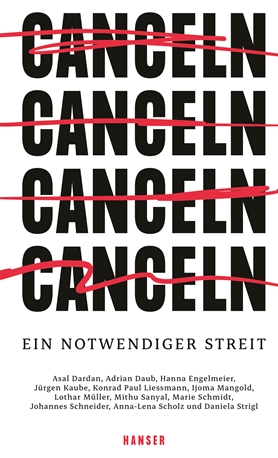
Das Wort »canceln« wurde erstmals 2014 bei Twitter in den USA verwendet – und das nur aus Spaß. Niemand ahnte damals, dass dieses Wort eine ganze Debatte auslösen würde, die es nun – fast zehn Jahre später – in ein Buch geschafft hat:
»Klar ist: Die Debatte berührt nicht nur einen Kern der Literatur, sondern auch unseres Zusammenlebens. Sie ist ein notwendiger Streit«, kündigte im März der Carl Hanser Verlag sein neues Buch »Canceln« an (erschienen am 20. März 2023).
Das Wort wurde damals schnell von marginalisierten Gruppen aufgegriffen und verbreitete sich unter dem Hashtag #CancelCulture rasant. Die Debatte hat – so scheint mir – ein wenig an Tempo verloren, aber sie ist nicht weniger brisant als noch vor fünf, sechs oder gar neun Jahren. Wir müssen darüber reden.
In der Urania Berlin hat in diesem Sinne am 28. Juni 2023 eine Podiumsdikussion zu diesem Buch und seinen kontroversen Fragen und Meinungen stattgefunden. Es diskutierten u. a. Anna-Lena Scholz (DIE ZEIT), Jürgen Kaube (FAZ), Ijoma Mangold (DIE ZEIT). Moderiert wurde die Veranstaltung von Christian Dunker (Buchhandlung Geistesblüten, Berlin).
Die Diskussion im Kleistsaal ist sich nicht einig geworden, aber sie hat sehr deutlich gezeigt, dass eine gewissen Gelassenheit eingekehrt ist, die Ijoma Mangold nicht nur formuliert, sondern auch ausgestrahlt hat. Das heiße Jahrzehnt der Diskussion um das Phänomen Cancel Culture ist abgeklungen, wenngleich es noch immer Thema ist. Es analytisch betrachten zu wollen, zeigt aber auch, dass es noch immer schwer fassbar ist, was Cancel Culture ist, weil sie keinem System folgt, keine statische Struktur entwickelt hat, sondern eine kulturelle Praxis ist, stellt Anna-Lena Scholz fest. Für diese Schwammigkeit dieses in seiner Wirkung jedoch radikalen Phänomens sollte auch das Radiergummi stehen, das am Eingang in den Kleistsaal an Besucher*innen ausgegeben wurde.

Die kulturelle Praxis Cancel Culture ist jedoch keineswegs eine schlichte Zensur eher so etwas wie ein moralisches Kommunikationsmittel, das sich auf eine diffuse Menge von Einzelereignissen bezieht, beobachtet Jürgen Kaube, das immer dann angewendet wird, wenn man juristisch nicht weiterkommt. Darin sind sich alle auf dem Podium weitgehend einig. Auch darin, dass eine Abrüstung der Sprache beim Sprechen über dieses Phänomen dringend angezeigt ist. Wörter wie »Ächtung« oder »Zensur« bringen uns nicht weiter. Viel entscheidender, aber auch kontroverser wendet sich die Diskussion der Frage zu, wer wann und warum spricht. Diese Frage, die den moralischen Kern der Debatte näher konturriert, wurde etwas schwach auf den Aspekt der Öffentlichkeit hin reflektiert, wenngleich Ijoma Mangold zumindest stichwortartig darauf verwiesen hat, dass die Entwicklung der sozialen Medien hier einen besonderen Einfluss nehmen, die – und das ist ein kluger Befund – begonnen haben, Situationen, Themen und Inhalte zu repsychologisieren, worüber »plötzlich« die Heterogenität der Gesellschaft sichtbar wird, die bis zum Durchbruch der sozialen Medien unsichtbar geblieben ist.
Wenngleich die Debatten, die Cancel Culture ausgelöst hat, die Inhalte derselben pluralisiert hat, wie vor allem Anna-Lena Scholz stark macht, ist dies doch nicht mehr als ein schöner Effekt. Im Kern geht es auch vor diesem Hintergrund um die Frage der Autorisierung der Sprecher. Charakteristikum der Cancel Culture ist auch, dass Sprecher, noch bevor sie ihre Position, ihre Meinung darlegen, verhindert werden. Problematisch bei der Verhandlung von Deutungshoheiten ist, dass Positionen gar nicht mehr zugelassen werden. Cancel Culture also als ein Phänomen der Öffnung zu lesen, wie es Anna-Lena Scholz vorgeschlagen hat, die sich vor allem mit dem Phänomen Cancel Culture im Wissenschaftsbetrieb beschäftigt, bleibt in dieser Runde meines Erachtens zurecht umstritten.
Vielmehr zeigt sich Cancel Culture als ein Phänomen der Verengung. Als eine also nicht nur kulturelle, sondern auch autoritäre Praxis, ein Machtdiskurs, bei dem es um Repräsentanz geht. Wer wird im Diskurs repräsentiert und wer nicht? Das »Gegenrepräsentieren«, also die Moralisierung und der Ausschluss des Sprechers (der dabei gewissermaßen doppelte Aufmerksamkeit erhält) sowie die Repräsentation des Betroffenen ex negativo, ist eine nicht minder »paternalistische Haltung«, argumentiert Ijoma Mangold. Der Kampf um Repräsentanz ist folglich nicht das, was Minderheiten sich wünschen würden, auf diese Art und Weise wollen sie nicht repräsentiert werden.
Bei Cancel Culture geht es nicht nur um die Mündigkeit des Sprechers, sondern auch die des Lesers und Zuhörers. Wer aber erkennt Rassismus in der Literatur? Rassismus ist oftmals subtil. Er lässt sich kaum auf die Position des Sprechers, einen Sprechertypus oder eine Reihe bestimmter Situationen beschränken. Und dennoch, auch das ist eine Position in dieser Runde, verbindet sich Rassismus vielfach mit einem Fetisch des Wortes, der teilweise a-historisch bleibt, so Jürgen Kaube, der seinen Beitrag in der Anthologie diesem Thema gewidmet hat. Soweit die Analyse, aber genügt das als Argument, um Werke der Vergangenheit auf ihr rassistisches Vokabular hin zu überarbeiten?
Es gibt kein besseres Ende, als ein Fragezeichen für die Reflexion dieses Diskurses, aber auch dieser Diskussion, nicht zuletzt, weil dieses Fragezeichen Anlass für das Buch Canceln – Ein notwendiger Streit aus dem Hanser Verlag ist. Das Buch ist reichhaltig bestückt mit vielseitigen Positionen und Stimmen (Asal Dardan, Adrian Daub, Hanna Engelmeier, Jürgen Kaube, Konrad Paul Liessmann, Ijoma Mangold, Lothar Müller, Mithu Sanyal, Marie Schmidt, Johannes Schneider, Anna-Lena Scholz und Daniela Strigl), die zu lesen und zu durchdenken sich lohnt. Bleiben Sie dran, nicht am Canceln, aber am Lesen und unbedingt am (Nach)Denken. Nur dann können wir uns annähern und entwickeln.


