frieda r. im Gespräch mit der Autorin Stefanie Gerhold über ihren Roman Das Lächeln der Königin
Im Verlag Galiani Berlin ist der Debütroman Das Lächeln der Königin von Stefanie Gerhold erschienen. Friederike Römhild hat die Autorin in Schöneberg getroffen und mit ihr über die weltberühmte Büste Nofretete, ihre Bedeutung für Berlin und für den Kunstmäzen James Simon gesprochen, dem sie in ihrem Roman ein Denkmal setzt. James Simon war einer der bedeutendsten Mäzene der Kunstgeschichte und starb vereinsamt und fast unbemerkt in Berlin.

Das Lächeln der Königin erzählt die Geschichte der weltberühmten Büste Nofretete, ihres Entdeckers Ludwig Borchardt und des Kunstsammlers James Simon. Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
Auf dieses Thema bin ich an dem Ort gestoßen, wo die Büste heute steht, nämlich im Neuen Museum in Berlin, dort gab es eine Ausstellung anlässlich ihrer hundertjährigen Ausgrabung, und diese Ausstellung war der Stadt Tell el-Amarna gewidmet. In dem Saal, in dem die Nofretete-Büste steht, war gleichzeitig eine Bronze-Büste von James Simon ausgestellt, und zwischen diesen beiden Büsten spielte sich etwas ab. Sie waren sehr raffiniert, halb schräg, gegenübergestellt. Mich hat diese Spannung zwischen dem, was sie repräsentieren, zwischen den Kulturen sofort gepackt. Dann habe ich angefangen zu lesen, und es wurde immer interessanter. Es hat Dinge zutage gebracht, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Für deinen Roman bist du in die Geschichte der Archäologie, der Ägyptologie, des Kunsthandels und auch in die Geschichte Berlins der 1910er und 20er-Jahre eingetaucht. Wie hast du dich den Fakten, aber auch diesen Persönlichkeiten angenähert?
Es hat eins zum anderen geführt. Ich habe zum Beispiel, um mich mit dem Milieu des jüdischen Bürgertums in Berlin vertraut zu machen, die Romane von Georg Hermann gelesen. Über diese Romane habe ich die Entdeckung gemacht, dass der Autor ein direkter Bruder von Ludwig Borchardt war. Georg Hermann war ein Künstlername. Letztlich ist es dann auch fast diesem Georg Hermann zu verdanken, dass sich das Trio Borchardt, Simon und Nofretete entwickelte, die letztlich viel interessantere Konstellation. Zu Ludwig Borchardt habe ich recht viel gefunden, er war Wissenschaftler, ein bestens ausgebildeter Archäologe, Ägyptologe, auch Architekt und hat etliche Schriften über das Alte Ägypten verfasst.
Was für Persönlichkeiten waren Ludwig Borchardt und James Simon? Wie würdest du sie charakterisieren?
Für mich sind sie ein Gegensatzpaar, das einen ähnlichen Ausgangspunkt hat. Sie entstammen beide aus dem jüdischen Bürgertum Berlins, waren beide Söhne von Textilhändlern, der eine, James Simon, hat die Firma seines Vaters übernommen. Er hat sich den Anforderungen und den Erwartungen seiner Familie gebeugt, aber in ihm schwelte die Leidenschaft für die Archäologie, die Kunstgeschichte und das Altertum. Diese Neigung konnte er letztlich nur ausleben, indem er andere gefördert hat, die das getan haben, was er selbst vielleicht gerne verwirklicht hätte. Dem gegenüber war Ludwig Borchardt der Willensstarke, der ausgebrochen ist. Sein Vater war nicht so erfolgreich, das heißt, auf ihm lastete nicht der Druck, eine erfolgreiche Firma weiterführen zu müssen. Borchardt hat sich mit seinem Wunsch durchgesetzt und hat, anders als James Simon, studiert und ist dann sogar nach Ägypten gegangen. Mutig und furchtlos. Er war auch jemand, der sich um seine Stellung in der Gesellschaft nicht geschert und ihr eher den Rücken gekehrt hat, weil es für die jüdischen Bürger nie einfach in Deutschland war.
Ganz anders James Simon, der sich der Gesellschaft bewusst zugewandt hat. Er war nicht nur Textilunternehmer und hat sich damit ein Vermögen erschaffen, mit dem er Kunst sammeln konnte. Wie sah sein Engagement aus?
Das fand ich sehr interessant. Ich habe das Thema immer auch soziologisch betrachtet. In der Gründerzeit gab es eine echte Aufbruchstimmung und viele Möglichkeiten, gleichzeitig hatten Juden nie Zugang zu den Schaltstellen, wo Dinge entschieden wurden. Diese Ambivalenz hat mich interessiert. Die Dankbarkeit dafür, dass man sich in Deutschland entfalten konnte, fand im Mäzenatentum seinen Ausdruck, in seinen großzügigen Förderungen sozialer Projekte. James Simon hat Kinderheime, Mädchenhorte, Ferienheime für Schulkinder, sogar eine Badeanstalt, man kann die Projekte kaum zählen, ermöglicht.
Dass wissen viele gar nicht, dass James Simon sozial gewirkt hat.
Ja, das ist vielleicht heute noch so, dass soziale Bereiche nicht dieses Prestige haben. Bei James Simon ist es diese Doppelfigur, also der Ausdruck der Dankbarkeit, dieses Bedürfnis der Gesellschaft etwas zurückzugeben, und gleichzeitig die damit verbundene Hoffnung oder der Wunsch, Anerkennung zu finden durch die gemeinnützige Arbeit.

James Simon hat diese Anerkennung lange nicht bekommen. Erst 2018 wurde in Berlin die James-Simon-Galerie von Angela Merkel, Bundeskanzlerin a. D., eröffnet. Das war ein sehr wichtiger Schritt für das kulturelle und jüdische Gedächtnis Berlins und Deutschlands. Hat James Simons auch zu Lebzeiten die ersehnte Anerkennung gefunden?
Der Höhepunkt seiner Anerkennung lag vor dem Ersten Weltkrieg, danach wurde alles schwierig, nicht nur die wirtschaftliche Lage im Zuge diverser Wirtschaftskrisen, sondern auch die wachsenden politischen Spannungen in der Weimarer Republik. Wie wir alle wissen, ist der Antisemitismus in einer Weise aufgeflammt, die diese Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben muss, und zwar nicht erst 1933.
Die Geschichte des Antisemitismus begann weit vorher, bereits im 19. Jahrhundert.
Aber das war noch eine Phase, in der der Weg für die Integration des jüdischen Bürgertums in unsere Gesellschaft in verschiedene Richtungen hätte weitergehen können. Die Anerkennung der Leistungen des jüdischen Bürgertums war mit der Weimarer Republik und dem zunehmenden Antisemitismus nicht mehr Teil der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges hatte die Chance, der Geschichte einen anderen Verlauf zu geben, zunichte gemacht.
Vor dem Krieg erlebte James Simons Baumwollunternehmen einen enormen Aufschwung, nach dem Krieg hatte er Schwierigkeiten sein Personal zu bezahlen, die eigenen Leute durchzubringen. War James Simon gescheitert?
James Simon war 1913, als die Nofretete gefunden wurde, der siebtreichste Berliner. Sein Baumwollunternehmen war das größte in ganz Deutschland. Entsprechend international war er aufgestellt, die Baumwolle wächst in den USA und in Ägypten, doch der Welthandel war auch damals von der Stabilität der Währung abhängig. Die Lage war für die international agierenden Unternehmen nach dem Ersten Weltkrieg und dem Einbruch der Mark sehr schwer.
Wie ist James Simon mit seiner Not umgegangen?
In der Krise hat er gezeigt, dass es ihm ernst gewesen ist mit seiner Verpflichtung gegenüber seinen Angestellten und der Gesellschaft. Sein oberstes Ziel war, diese Firma am Leben zu erhalten, seine Leute zu bezahlen, und dafür hat er in Kauf genommen, persönlich zurückzustecken. Er hat in einer unglaublichen Villa residiert, die sich an der Stelle befindet, wo heute die Badenwürttembergische Landesvertretung steht, direkt am Tiergarten. Das riesige Haus hatte sein Vater gebaut, der den ersten Aufstieg mit der Firma geschafft hatte. Dieses Haus hat James Simon verkauft und als Mieter darin weitergewohnt. Ich finde es beachtlich, diese persönliche Demütigung, die man darin auch sehen kann, in Kauf zu nehmen.
James Simon scheint trotz seines Schmerzes die Veränderungen mit einer großen Haltung und Fassung getragen zu haben.
Diese Bescheidenheit, die ihm tatsächlich nachgesagt wird, habe ich nicht erfunden.
Er hat später angefangen, Werke zu verkaufen, die ihm persönlich viel bedeutet haben, um die wirtschaftliche Krise zu bewältigen. Du hebst ein Bild besonders hervor. Was ist da passiert?
Das ist der zweite Komplex, den ich aufrolle in dem Roman, dass er nicht nur als Mäzen oder Finanzier der Ausgrabungen in Ägypten sehr viel geleistet hat, sondern auch direkt als Ankäufer für die Berliner Gemäldesammlungen, die sich damals im Aufbau befanden, und ganz konkret für Wilhelm Bode, der Simon an seinem Wissen teilhaben ließ. Eine Weile lang war das für beide richtig gut, aber es entwickelte sich in einer Richtung, aus der sich James Simon befreien wollte. Es wurde immer deutlicher, dass er sich als Lieferant von Bildern missbraucht sah und Bode ihm aufdrängen wollte, welche Bilder er zu kaufen habe. Der Konflikt, der sich aus dieser wachsenden Bevormundung entwickelte, führte zur Distanzierung voneinander. James Simon schwor deshalb der Kunst und dem Sammeln nicht ab, er hat die europäische Malerei geliebt und sich auch in seinen Privaträumen mit Gemälden umgeben. Sich vorzustellen, man trinkt morgens seinen Kaffee und guckt sich einen Mantegna an, allein diese Vorstellung hat mich fasziniert. Und da kommt eben dieses eine Bild ins Spiel, das ich herausgegriffen habe als Beispiel für diese schmerzvolle Desillusionierung oder diesen Abstieg. Es ist eines dieser sehr schönen Gemälde von Vermeer, Die Herren und ihre Magd. James Simon hatte es angekauft, immer mit dem Hintergedanken, dass er es irgendwann Wilhelm Bode für sein Museum stiften würde. Später entschied er sich, es zu verkaufen, weil er Geld brauchte. Das Bild ist heute in New York in der Flick-Collection beheimatet.
Neben Wilhelm Bode, mit dem ihm ein schwieriges Verhältnis verband, gab es einen wirklich guten Freund, Fritz Grosz. Wer war das und welche Rolle spielte er im Leben von James Simon?
Fritz Grosz ist in meinem Roman ein Wirtschaftsanwalt und für James Simon ein wichtiger Ratgeber. Er ist die Person, die ihm die Augen für die Realität öffnet und ihm auch mal sagt, dass er nicht immer nur lieb und nett sein und alles auf seine Kappe nehmen kann. Er ist im Grunde der Realist, in dem sich James Simons Charakter spiegelt, der auch schwierige Seiten hatte.
In Das Lächeln der Königin lernen wir James Simon auch als einen emotionalen Menschen, einen Privatmenschen kennen. Wir beobachten ihn nicht nur von außen, sondern bekommen Einblick in sein Inneres. Mit seiner Familie hatte er es nicht immer leicht. Wie war das?
Sein Vater, der ja noch ein einfacher Schneider gewesen war, wollte seinen Sohn so gut wie möglich verheiraten. James Simon war dann mit Agnes Reichenheim verheiratet. Die Seidenhändler-Familie Reichenheim war viel vornehmer und eingesessener in Berlin als die Simons. In dieser Verbindung liegt von vornherein eine Grundspannung, denn für eine Agnes Reichenheim wäre es möglich gewesen, in den Adelsstand zu heiraten, das jüdische Milieu zu verlassen und auf einen Schlag ganz andere Zugänge zur damaligen High Society zu bekommen. Beide waren Kinder, die den Erwartungen ihrer Familie Folge leisten wollten. Sie waren nicht frei. Zusätzlich hatten sie ein behindertes Kind. Ihre Tochter Marie Luise wurde nur vierzehn Jahre alt. Das war eine Prüfung, die ich mit seinen großzügigen Schenkungen in Verbindung gebracht habe. Etwa zwei Jahre nach ihrem Tod schenkte James Simon 21 Gemälde aus der italienischen Renaissance an das Kaiser-Friedrich-Museum. Wenn man also das Liebste, was man hat, verliert, kann man im Grunde alles verschenken. Sein Herz im Moment des größten Schmerzes zu öffnen, hat sich auf frappierende Weise wiederholt, als er die Nofretete-Büste zeitnah zum Tode seiner Frau verschenkte.

Wir Leser:innen haben die Chance einen ganz besonderen Blick auf diese Büste zu bekommen. Du erzählst, wie James Simon diesen einzigartigen Fund betrachtet. Was ist das für ein Blick?
Das war mir tatsächlich eines der größten Vergnügen, diese Büste noch einmal so zu sehen, als würde man sie zum ersten Mal sehen. Das ist bei so einer Ikone und einem durch seine häufige Darstellung fast entleerten Kunstwerk eine sehr reizvolle Aufgabe. Sich vorzustellen, sie ist gerade aus dem Sand gekommen und landet auf James Simon Schreibtisch in Berlin, und niemand, außer Ludwig Borchardt, weiß von dieser »Gestalt«. Das ist eine verrückte Sache, ganz unabhängig von der Frage der Legitimation, dem Kolonialismus und den Fundteilungen, muss sich auch ein James Simon gefragt haben, wie komme ich dazu, dass ich diese 3000 Jahre alte Büste in diesem Erhaltungszustand, in ihrer Farbigkeit und Pracht, ja ihrer Schönheit besitzen darf. In der Begegnung versuche ich nachzuvollziehen, wie es ist, sie zu besitzen. James Simon ringt in der Schlüsselszene des Romans damit, sich mit seinem Blick auf ihre Höhe zu begeben, sie sich menschlicher zu machen und die Distanz zu überwinden. Dabei findet er das Lächeln dieser Königin, sodass sie für ihn nicht nur erhaben, autoritär und unerreichbar ist, sondern auch etwas Mildes hat.
Als Leserin kann man sich gut in diese Überwältigung einfühlen, es entsteht eine emotionale Nähe zu James Simon, das fand ich sehr schön. Aber es ging um mehr. Worum genau?
Mit der emotionalen Überwältigung verband sich auch der Gedanke, den Berliner Museen durch diesen spektakulären Fund endlich einen Rang in der Welt geben zu können. Tatsächlich ist die Ägyptische Sammlung durch dieses Exponat weltberühmt geworden. Dieser Gedanke hat James Simon von Anfang an mit Glück erfüllt. Doch das Versprechen, das die Büste für ihn verkörperte, hat sich zu seinen Lebzeiten zum Gegenteil verkehrt.
Es wurde zu einem komplizierten Konflikt.
Die politische Dimension davon hatte ich nicht geahnt, als ich zu recherchieren begann. Diese Geschichte wird selten erzählt. In der Büste verdichten sich, weil sie so einzigartig ist, alle Fragen, die uns noch heute beschäftigen: das ganze Begehren, das diese Büste auslöste, und die Situation in Ägypten, die so komplex war wie in kaum einem anderen Land. Ägypten war offiziell keine Kolonie, aber finanziell vollständig abhängig von Großbritannien und Frankreich, die wiederum beide im Konflikt miteinander standen und Ägypten quasi zu einer Kolonie verwandelt haben. Sie übernahmen politische Ämter wie den Antikendienst, der von Frankreich geleitet wurde.
Bis die Nofretete auf James Simons Schreibtisch stand, war es ein weiter Weg. Es war lange nicht sicher, ob und wie sie überhaupt nach Berlin kommt. Heute gehen wir sehr selbstverständlich ins Museum und sehen sie uns an, aber dass wir das können, ist ein riesiges Glück. Steht uns Nofretete eigentlich zu?
Es stand auf der Kippe, ob sie nach Berlin kommt. Ludwig Borchardt hat nicht daran geglaubt. In der ägyptischen Altertümerverwaltung, dem Service des Antiquités, fand ein Leitungswechsel statt. Der scheidende Direktor Maspero war verärgert über die neuen Regelungen zu den Fundteilungen, die die Engländer aufgestellt hatten. Möglicherweise hat man in dieser Situation, das muss man mit Vorsicht sagen, nicht so genau hingesehen. Was mich an der Sache vor allem interessiert hat, sind zwei Dinge: Erstens, dass James Simon wohl tatsächlich das erste Mal seinen Vorsatz, sich nicht einzumischen, sondern nur Grabungen zu finanzieren, überschritten hat, indem er später Geld bot, um diese Büste zu bekommen. Das war eigentlich nicht korrekt. Und zweitens, wie Borchardts Verhalten zu beurteilen ist. Bis heute gibt es Stimmen, die sagen, dass Ludwig Borchardt die Behörden betrogen und diese Büste mit Dreck zugeschmiert hätte. Hier brechen sich antisemitische Stereotypen Bahn. Es ist eine Blackbox, was da wirklich passiert ist. Das ist bis heute nicht geklärt. Die Papiere sind alle korrekt, dass ist das, worauf sich die Berliner Museen berufen können, weshalb dieser Besitz juristisch nicht infrage gestellt ist. Die Frage ist aber schon, inwieweit man Entscheidungen, die damals unter undurchsichtigen Umständen getroffen wurden, als abgeschlossen betrachten kann.
In der Restitutionsfrage liegt die höchst politische Dimension dieser Geschichte. Ist sie möglicherweise einer der Gründe, wieso man sich mit James Simon lange nicht richtig beschäftigt hat?
Die Sache wurde elend, um es kurz zu sagen, denn Nofretete wurde zwölf Jahre lang nicht ausgestellt. Niemand durfte sie sehen, weil sich Ludwig Borchardt dagegen gesträubt hatte, und dann kam noch der Erste Weltkrieg, das war Borchardt alles zu heiß. James Simon hat sie irgendwann an das Museum verschenkt, bis dahin waren es nur Dauerleihgaben. Sie war aber der Öffentlichkeit immer noch nicht zugänglich. Als sie dann ausgestellt wurde, nämlich vor 100 Jahren, ereignete sich das, was Borchardt befürchtet hatte. Es ging ein riesiger Streit über die Rückgabe los, von französischer Seite, stellvertretend für Ägypten. Dem fiel Borchardt zum Opfer, muss man sagen. Er hat sich seinerzeit bemüht, die Grabungserlaubnis für Tell el-Amarna wiederzubekommen. Im Ersten Weltkrieg wurden die Archäologen aus Ägypten ausgewiesen, aber sie kamen nach und nach zurück. Borchardt hatte sich dieser Stadt verschrieben, er hat Tell el-Amarna akribisch und mit preußischer Manier ausgegraben, und aufgrund dieses Streits um die Büste durfte Borchardt seine Grabungen nie fortsetzen. Das ist mir nahegegangen. Die Situation war völlig verfahren. Es wurden zwischenzeitlich Tauschverhandlungen geführt zwischen dem Museum in Berlin und dem Museum in Kairo, und als eine Einigung in Sicht war, hat Berlin auf einmal einen Rückzieher gemacht. Die Empörung der Berliner über die geplante Rückgabe war so groß, dass ein riesiger Presseskandal entstand. Die Rückgabe war zu dieser Zeit, im Jahr 1930, politisch nicht durchsetzbar. Es ist dieser Moment, auf den ich hinauswollte, denn daraufhin hat James Simon das erste Mal öffentlich Farbe bekannt. In einem offenen Brief forderte er dazu auf, die Büste, der er sich so sehr verbunden fühlte, an Ägypten zurückzugeben.
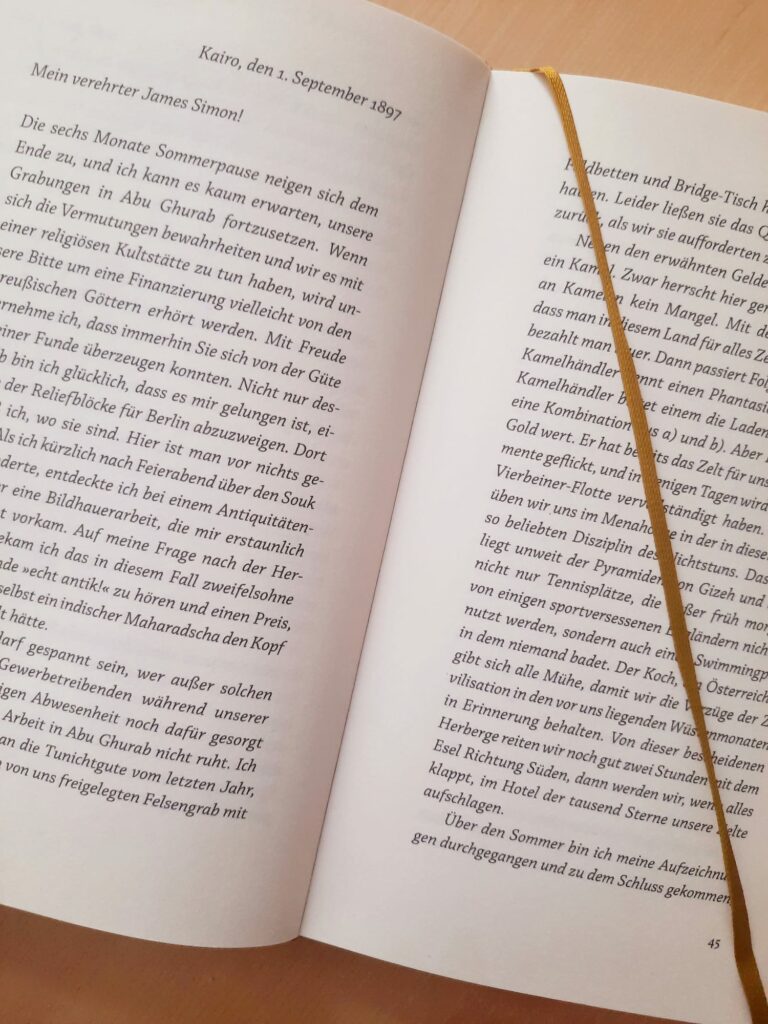

Die Briefform spielt mehrfach in deinem Roman eine wichtige Rolle, Simon und Borchardt schreiben sich Briefe. Wie viele dieser Briefe gibt es noch und wie hast du sie ausgewählt?
Ich habe die Briefe fast vollständig selbst geschrieben. Ich habe viele Briefe von Ludwig Borchardt und ein paar wenige Zeilen von James Simon gefunden, da ist wesentlich weniger erhalten, weil er nicht als Wissenschaftler publiziert hat. Borchardt hat viele Grabungen für die Deutsche Orientgesellschaft dokumentiert, die der Träger der Ausgrabungen war und unter anderen von James Simon gegründet wurde. Die Mitteilungsblätter für Mitglieder und Spender haben oft einen persönlichen Ton. Ich habe zum Beispiel den Humor analysiert, und ich habe Passagen aus den Berichten genommen und in meine Briefe eingebaut. Die Teile, die einem am unwahrscheinlichsten erscheinen mögen, sind echt. Die Briefe und Berichte waren wirklich kurios.
Auch die Klärung der Konflikte mit den Institutionen lief über Briefe ab, die damals einen noch sehr langen Weg hatten. Was hat dich an der Briefform besonders interessiert?
Die Kommunikation war ungemein schwieriger. Ich fand es spannend, nachzuempfinden, wie die Kommunikation über Briefe ablief und was ein Brief auslösen konnte. In dem Stil, in dem damals geschrieben wurde, erkenne ich die Bemühung wieder, keine Missverständnisse aufkommen lassen zu wollen. Es gab damals eine große rhetorische Vorsicht, etwas, was uns heute nicht mehr zu eigen ist.
Und wir erleben in deinem Roman, wie die Briefe Ludwig Borchardts und auch die seiner reizenden und einfühlsamen Frau Emilie auf James Simon gewirkt haben.
Spannend sind die Briefe auch deshalb, weil sie für James Simon der einzige Weg waren, ein Bild von Ägypten zu bekommen. Er ist selbst nie dort gewesen. Seine Frau Agnes war krank, und er konnte nicht nach Ägypten reisen. Ludwig Borchardt und seine Frau Emilie, der James Simon in seiner kriselnden Ehe zugewandt war, wollten sie schon lange empfangen. Diese Sehnsucht, diese ungelebten Träume stehen für diese Persönlichkeit, für James Simon. Daher sind die Briefe aus seiner Sicht so aufgeladen, weil er nur diese hatte.
Und in der Literatur findet diese Sehnsucht ein Gedächtnis. Vielen Dank für das Gespräch!
*
Termine & Autorin
Stefanie Gerhold wird am 16. September 2024 anlässlich der Jüdischen Kulturtage Berlin auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte aus ihrem Roman lesen. Den genauen Termin erfahren Sie unter www.juedische-kulturtage.org.
Stefanie Gerhold bei Galiani: www.galiani.de/autor/stefanie-gerhold
*
Das Gespräch führte Friederike Römhild, Berlin, im Mai 2024
Fotos von Stefanie Gerhold © Michaela Krause


